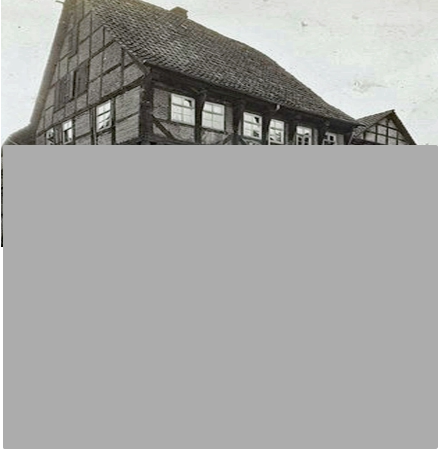Geschichtsverein Sydekum
Aktuelle Veranstaltung
Der Heimat- und Geschichtsverein Sydekum e.V. lädt zu einem Vortrag ein:
Thema: Vortrag „von der Weser bis zur Wartburg“, er thematisiert die Tourismusgeschichte in unserer Region
vor ungefähr 70-120 Jahren. Gezeigt werden alte, zum Teil seltene Bilder und Ansichtskarten.
Wann: Donnerstag, 27.2.2025 um 19.00 Uhr im Lepantosaal, Welfenschloss
Referent: Klaus-Dieter Flader aus Mielenhausen
Bereits vor über 100 Jahren bot Hann. Münden zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten und Ausflugsziele,
die damals zu Fuß mit Bahn, Schiff oder später mit Post- und Reisebussen zu erreichen waren.
Angefangen bei den Übernachtungsmöglichkeiten und einigen lokalen Ausflugsmöglichkeiten rund um Hann.
Münden führt die virtuelle Reise zunächst durchs Schedetal, zum Hohen Hagen, nach Göttingen und
anschließender Fahrt mit der Gartetalbahn.
Dann folgt ein Ausflug entlang der Werra von Laubach bis Bad Sooden-Allendorf.
Weiter geht’s mit dem Schiff auf der auf Fulda entlang mit den damals zahlreichen Einkehrmöglichkeiten am
Fluss bis nach Kassel mit den dortigen Sehenswürdigkeiten und Großveranstaltungen.
Natürlich gehört auch eine Fahrt mit dem Weser Dampfer bis nach Hameln dazu.
Am Ende des Vortrages geht die Reise nach Bad Wildungen, dem damals neuen Edersee und zur Wartburg.
Klaus-Dieter Flader hat bereits letztes Jahr am Beispiel der Dransfelder Bahnstrecke gezeigt, dass er sein im
Laufe von Jahrzehnten gesammeltes Bild- und Quellenmaterial hervorragend in spannender und informativer
Form “rüberbringen” kann. Der Verein freut sich, dass er ihn für einen Vortrag über ein bisher eher
stiefmütterlich behandeltes Thema gewinnen konnte, das seit dem 19. Jahrhundert bis heute ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor unserer Stadt und ihrer Umgebung ist!
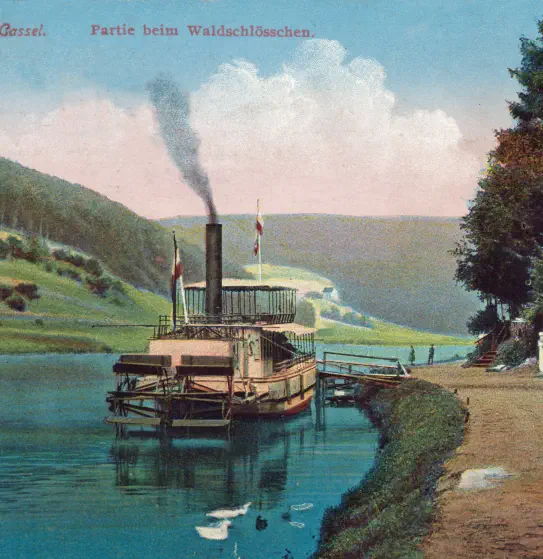
Aktuelle Veranstaltung
Der Heimat- und Geschichtsverein Sydekum e.V. lädt zu einem
Vortrag ein:
Thema: Vortrag „von der Weser bis zur Wartburg“, er thematisiert
die Tourismusgeschichte in unserer Region vor ungefähr 70-120
Jahren. Gezeigt werden alte, zum Teil seltene Bilder und
Ansichtskarten.
Wann: Donnerstag, 27.2.2025 um 19.00 Uhr im Lepantosaal,
Welfenschloss
Referent: Klaus-Dieter Flader aus Mielenhausen
Bereits vor über 100 Jahren bot Hann. Münden zahlreiche
Übernachtungsmöglichkeiten und Ausflugsziele, die damals zu Fuß
mit Bahn, Schiff oder später mit Post- und Reisebussen zu
erreichen waren.
Angefangen bei den Übernachtungsmöglichkeiten und einigen
lokalen Ausflugsmöglichkeiten rund um Hann. Münden führt die
virtuelle Reise zunächst durchs Schedetal, zum Hohen Hagen,
nach Göttingen und anschließender Fahrt mit der Gartetalbahn.
Dann folgt ein Ausflug entlang der Werra von Laubach bis Bad
Sooden-Allendorf.
Weiter geht’s mit dem Schiff auf der auf Fulda entlang mit den
damals zahlreichen Einkehrmöglichkeiten am Fluss bis nach
Kassel mit den dortigen Sehenswürdigkeiten und
Großveranstaltungen.
Natürlich gehört auch eine Fahrt mit dem Weser Dampfer bis nach
Hameln dazu.
Am Ende des Vortrages geht die Reise nach Bad Wildungen, dem
damals neuen Edersee und zur Wartburg.
Klaus-Dieter Flader hat bereits letztes Jahr am Beispiel der
Dransfelder Bahnstrecke gezeigt, dass er sein im Laufe von
Jahrzehnten gesammeltes Bild- und Quellenmaterial hervorragend
in spannender und informativer Form “rüberbringen” kann. Der
Verein freut sich, dass er ihn für einen Vortrag über ein bisher eher
stiefmütterlich behandeltes Thema gewinnen konnte, das seit dem
19. Jahrhundert bis heute ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
unserer Stadt und ihrer Umgebung ist!
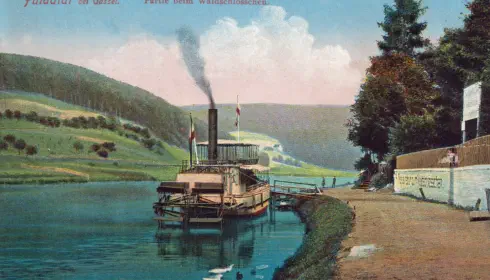
Geschichtsverein Sydekum